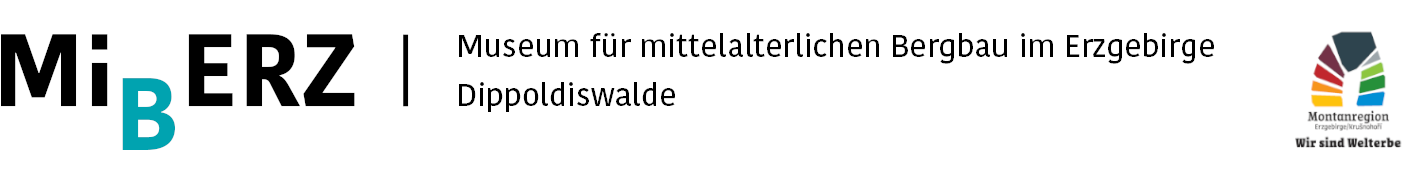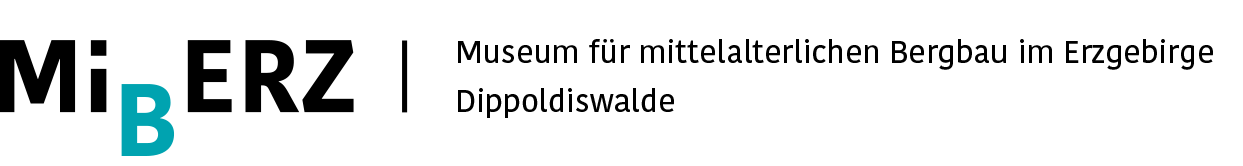Aktueller Sonderfund
Musik, Musik, Musik…
Zum neuen Fund im MiBERZ
Wir Menschen hören Musik, wir machen Musik und das seit Menschengedenken, überall in der Welt. Unser ältestes Instrument ist unsere Stimme mit unserem Körper als Resonanzraum. Musik gehört zum angenehmen Zeitvertreib, zu Ritualen und Festen. Wir tauschen uns mit ihr aus, senden Botschaften. Mit ihr können unsere Gefühle durchgehen, wir tanzen oder weinen oder beides zugleich.
Die ersten gefertigten Instrumente waren wohl Flöten, vor 45.000 bis 50.000 Jahren aus Knochen sehr kunstfertig hergestellt. Mit Flöten oder Pfeifen aus Knochen ist auch später noch musiziert worden.
Im Hohen Mittelalter verfeinerten sich die Sitten an den fürstlichen Höfen. Passende Instrumente wurden gebaut. Die Troubadoure und Minnesänger tourten durch Europa. Manch ein Fürst betätigte sich selbst als Minnesänger, wie Markgraf Heinrich der Erlauchte von Meißen. Auf der Wartburg fand der legendäre Sängerwettstreit statt.
Zu den Instrumenten bei Hofe gehörten die Harfe, die Laute, die Leier, Flöte, Trompete, Rahmentrommel. Manche Instrumente durften nur für die Fürsten erklingen. Mit anderen spielten die Spielleute auch auf Märkten und zu Volksfesten, wie Flöte und Fidel.
Im MiBERZ zeigt der Sonderfund derzeit volkstümliche Musikinstrumente, wie Knochenflöten, eine Wasserpfeife, Fragmente eines Blasinstrumentes sowie eine Figurpfeife. Diese Objekte sind Leihgaben des Landesamt für Archäologie Sachsen.
Am 13. April steht der Nachmittag ganz im Zeichen der Musik. Zwischen 14 und 17 Uhr können Sie sich über die Musik und die Instrumente des Mittelalters informieren. Sie erfahren mehr zur Geschichte unserer Musikinstrumente. Natürlich gibt es Live-Musik. Wer will, kann sich ein einfaches Instrument selbst gestalten.
Es gelten die regulären Eintrittspreise.
Das Programm ist im Eintrittspreis inbegriffen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.
Schauen Sie vorbei!